Sie haben das Unternehmen Staud 1971 von Ihrem Vater übernommen. Damals war es ein Großhandel für Obst und Gemüse. Wie kamen Sie darauf, Delikatessen zu erzeugen?
Staud: Die Idee dazu ist mir während meines Studiums an der Hochschule für Welthandel gekommen. Unsere Lehrer hatten uns ermuntert, Produkte nicht nur zu handeln, sondern auch zu veredeln. Und das habe ich wörtlich genommen.
Wie hat Ihre Familie diese Idee aufgenommen?
Staud: Mein Vater war sehr skeptisch. Er wollte, dass ich nach Deutschland gehe und dort Geld verdiene. Ich habe deshalb heimlich zwischen den Obstkisten im Lager Marillenkompott gekocht und Gurken eingelegt. Meine Mutter hat mich gedeckt. Die ganze Sache ist allerdings aufgeflogen, als wir Rechnungen für die verkauften Produkte schreiben mussten und mein Vater das Rechnungsbuch überprüft hat.
Hat Ihr Vater noch erlebt, wie erfolgreich Sie das Unternehmen weitergeführt haben?
Staud: Ja, kurz vor seinem Tod war er stolz auf mich. Davor nicht. Das war die gekränkte Eitelkeit, wie das halt oft so ist zwischen Vätern und Söhnen.
Wollten Sie nie irgendetwas anderes machen?
Staud: Wäre es nach dem Wunsch meines Musiklehrers gegangen, dann wäre ich Cellist geworden. Aber ich habe Mozart, Händel und Bach gehasst, das ist keine Musik für einen 17-Jährigen. Ich wollte die Beatles und die Rolling Stones hören, die damals gerade groß geworden sind. In meiner Freizeit musiziere ich aber bis heute gerne, immer wieder auch samstags auf der Orgel hier im Pavillon.
Wie geht es mit dem Unternehmen weiter, an wen übergeben Sie?
Staud: Da ich keine eigenen Kinder habe, sind zwei meiner langjährigen Mitarbeiter mittlerweile Teil der Geschäftsführung und wollen das Unternehmen in meinem Sinne weiterführen. Das ist ein schönes Gefühl.
Was sind aus Ihrer Sicht die Besonderheiten – in positiver und negativer Hinsicht – eines Familienbetriebs?
Staud: Wesentlich war, dass ich alleine durch dick und dünn gehen und mir die Hörner abstoßen musste. Das ist, denke ich, ganz gesund für einen jungen Menschen.
Was braucht es, um dabei erfolgreich zu sein?
Staud: Am wichtigsten sind das konsequente Denken, die Disziplin und das Durchhaltevermögen. Es ist außerdem entscheidend, nicht gleich beim ersten Gegenwind aufzugeben. Denn natürlich gab es auch Schwierigkeiten, am meisten mit der Bürokratie, die mit den Jahren gekommen ist. Früher hat jeder quasi einfach drauflos gearbeitet. Das wäre heute nicht mehr möglich.
Inwiefern trägt das Label Familienbetrieb zu Ihrem Image bei?
Staud: Ich weiß nicht, ob es vordergründig wichtig ist. Natürlich, vom Aspekt des Gewohnten, des bereits Bekannten ist es wichtig, aber nicht ausschließlich. Ich finde, man sollte mehr in die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit.
Wie viel »Familie« ist die Belegschaft von Staud? Was tun Sie als Arbeitgeber für Ihre Mitarbeiter?
Staud: Zur Zeit des Jugoslawien-Krieges hat es viele Streitereien innerhalb unserer internationalen Belegschaft gegeben. Ich habe dann gesagt, hier ist kein Krieg, hier ist Frieden. Wir sind in Wien. Und dann habe ich sie auf Serbisch geschimpft – so würde ich das heute nicht mehr sagen – und das hat etwas bewirkt. Ich habe Serbisch gelernt, damit ich mich mit den Mitarbeitern verständigen konnte bzw. ich sie verstehen konnte.
Wenn Sie heute noch mal 20 Jahre alt wären: Würden Sie wieder ein Unternehmen gründen und, wenn ja, welches?
Staud: Jein, heute gibt es schon alles. Damals konnte man machen, was man wollte, es gab keine Konkurrenz, alles hatte Neuheitscharakter. Ich wüsste nicht, was ich heute erfinden sollte. Das einzige, was ich hatte, waren mein guter Geschmackssinn und mein Sinn für Ästhetik. Das hatte ich von meinen Eltern. Dafür habe ich auch ständig eine auf den Deckel bekommen, weil ich so heikel war. Alle Dinge, die man in der Volksschule im Halbinternat essen musste, waren ekelhaft für mich.
Ihre Familie ist seit fast 150 Jahren in Ottakring zu Hause. Was schätzen Sie an Ihrem Heimatgrätzel?
Staud: Meine Eltern haben mich hier hineingesetzt und ich wollte nie weg, auch wenn wir immer wieder Platzprobleme haben. Die engen Straßen sind mühsam für LKW und Sattelschlepper. Aber wir haben keine Schwierigkeiten mit den Anrainern, im Gegenteil: Die reklamieren nur, dass es zu wenig riecht. Früher haben wir offen gekocht, jetzt, im Vakuum, da riecht man nichts mehr.
Sie setzen sich schon sehr lange aktiv für den Brunnenmarkt und seine Standler ein. Das ganze Viertel hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Was würden Sie sich denn für den Markt noch wünschen?
Staud: Die Leute haben gesagt, du bist deppert, warum investierst du da und nicht am Naschmarkt? Aber ich gehöre hierher, das ist meine Heimat. Wenn alle wegziehen von hier, wäre es ein Ghetto. Und nach und nach haben wir den Yppenplatz zu dem gemacht, was er heute ist. Es dauert halt alles seine Zeit, wie das so ist bei der Stadtentwicklung. Nicht mal mit viel Geld geht das schnell. Ich wünsche mir, dass der Markt so bleibt, wie er ist.
Sie haben immer wieder darüber nachgedacht, mit der Produktion aus Wien abzuwandern. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
Staud: Die Politik ist gefordert, wir brauchen ein Angebot für einen neuen Standort. Wenn man Manufacturing in der Stadt halten will – und ich finde es wichtig, dass es einen ausgewogenen Mix an Unternehmen gibt und keine tote Stadt –, braucht es politisches Entgegenkommen.
Wie viel Ihrer Produkte verkaufen Sie im Inland und wie viel im Ausland?
Staud: Drei Viertel im Inland, den Rest im Ausland. Aber der Auslandsanteil ist steigend, das Inland ist gesättigt.
Wie biologisch sind Ihre Produkte?
Staud: Der Bioanteil steigt aufgrund der massenhaften Nachfrage stark. Für mich muss das Produkt zuerst gut schmecken und gut aussehen. Wenn es dann noch bio ist, umso besser. Ich kaufe alles, was ich bekommen kann, in Österreich, den Rest primär im EU-Ausland.
Was ist Ihr Lieblingsprodukt aus Ihrem Sortiment?
Staud: Zwetschkenröster und Marillenkonfitüre.
Das heißt, Sie essen jeden Tag zum Frühstück ein Marmeladebrot mit Ihrer eigenen Marmelade?
Staud: Nein, pfui, das habe ich nie gegessen (lacht). Marmelade schon, aber nur in Mehlspeisen wie in Palatschinken. Der Grund dafür ist die grausliche Marmelade in der Schule. Da wurde mir ins Mitteilungsheft geschrieben: Sohn isst Jause nicht. Mein Vater kam dann in die Schule, hat das Marmeladebrot gekostet und ausgespuckt und gesagt: Recht hat er.
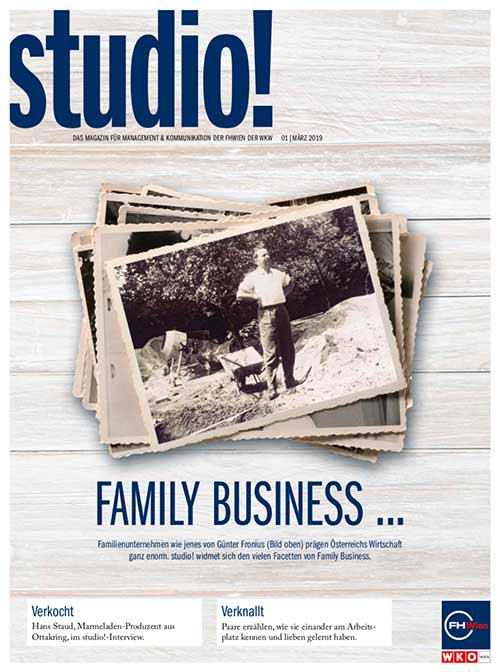
-
Cover Story: ... erfolgreich in die Zukunft führen
Familienunternehmen spielen in der österreichischen Wirtschaft eine tragende Rolle – auch, weil Erfolg für sie oft eine ganz spezielle Bedeutung hat. Über Tradition, Werte und unternehmerische Verantwortung. von Mascha K.…Familienunternehmen spielen in der österreichischen Wirtschaft eine tragende Rolle –… -
Im Interview: Hans Staud – „Ich habe nie Marmeladebrote gegessen“
Seine Marmeladen sind Wiener Tradition, sein Unternehmen ist seit rund 150 Jahren in Ottakring beheimatet: Der Delikatessen-Produzent Hans Staud erzählt im studio!-Interview, wie ihn die Schulzeit kulinarisch geprägt hat, was…Seine Marmeladen sind Wiener Tradition, sein Unternehmen ist seit rund…